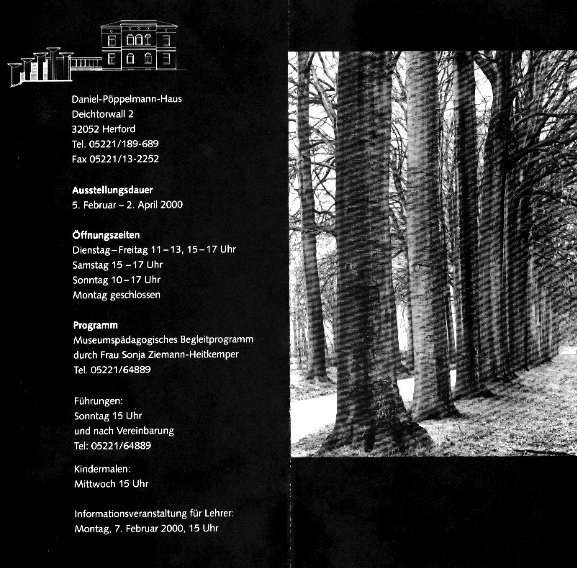-
- Die Bilder des Fotografen Albert Renger-Patzsch -
-
- sie hängen jetzt vor uns hinter uns an den Wänden des Daniel-Pöppelmann-Hauses - eines Kunstmuseums - also doch. Immer hat sich dieser Mann gegen die Versuche anderer Fotografen gewehrt, Malerei und Grafik mit dem Material der Fotografie nachzuahmen, wie es die Kunstfotografie um die Jahrhundertwende versuchte,"impressionistische" Unschärfe, symbolistische Verschränkungen melancholischer Frauen im damals längst nicht mehr jungen Jugendstil, um aus dem Dilemma herauszukommen, dass die Fotografie nicht als Kunst anerkannt wird, die ja in erster Linie eine Technik ist, eine Technik allerdings, hervoragend geeignet zur Wiedergabe des Sichtbaren.
- "Indem der Photograph die Natur im Lichtbild durch verwischte Konturen, verschwommene Linien wiedergibt, glaubt er, Maler geworden zu sein, der Pinsel und Leinwand mit Linse und Bromsilberplatte vertauscht und nun die"impressionistische" Photographie" schafft. ... Es ringt sich .. die Erkenntnis durch, dass die Photographie in ganz hervorragendem Masse selbstschöpferisch sein kann, wenn sie sich ausschliesslich der Mittel bedient, die Ihr durch die eigene Technik gegeben sind", schreibt 1928 im Berliner Tageblatt der Kritiker Werner Goldschmidt.
- (nach K.Honnef, S 15)."Kunst", sagte sein Zeitgenosse, der Künstler Paul Klee, gibt nicht das Sichtbare wieder, Kunst macht sichtbar". Also was? Was tun? Als Renger-Patszch seine bildnerische Arbeit beginnt, Mitte der 20er Jahren, hatte in der Malerei der Kubismus seine Phasen durchlaufen, der Expressionismus sich verbraucht, die Dadabewegung ihre grimmigen Scherze von Zerstörung und absurder Konstruktion bis zum Überdruss getrieben. Der Surrealismus versuchte sich in den Ängsten und Lüsten der Traumtiefen. Die Kunst verlangte nach einer Atempause auf der einen, nach einem Abschwirren in surreale Traumwelten oder in das Pathos des politischen Engagements auf der anderen Seite. In diese Zeit der Besinnung der Ernüchterung, des Anhaltens atemloser Innovation fällt sicher nicht ganz zufällig die Fotografie von Renger-Patzsch mit ihrem spezifisch fotografischen Ansatz.
- Genaues Hinsehen, scharfer nüchterner Blick, kein Pathos, keine subjektive Leidenschaft, Träume vorerst abgeschaltet. Die Welt ist eigentümlich genug, man muss sie nicht neu erfinden und sich auch nicht eine andere erträumen. Auch die Grenzen der Fähigkeiten der Kamera werden nüchtern gesehen und als eigene Begrenzung angenommen. Das Detail wird wichtig, wo man das Ganze schon von den technischen Möglichkeiten her nicht deuten oder gar erfassen kann. Der Ausschnitt bestimmt die Bildform, aber dieser mit mit sorgfältig kalkulierter Auswahl. Der Gegenstand bleibt bildbestimmend, aber dies mit äusserster Schärfe. Farbe bleibt ausgeblendet, aber die Reduktion auf schwarz-weiss wird kompensiert durch die mögliche Fülle der Abstufungen und Zwischentöne im Graubereich. Die rechteckige Begrenzung des Weltbildes durch Sucher oder Mattscheibe wird endgültige Bildform in sorgfältig austarierten Kompositionen. Wenn man eine Parallele zur Kunstentwicklung dieser Zeit suchen will, dann findet man sie vielleicht noch in Konzeption und malerischer Praxis der Neuen Sachlichkeit der zwanziger und dreissiger Jahre. Nachdem viele Fotografen im Dunst der Kunstfotografie versucht hatten, die fotografische Technik nach Möglichkeit zu verschleiern, um eine Aufnahme in die Weihesäle der Kunst zu erschleichen, setzt Renger-Patzsch gerade auf diese Technik und verzichtet auf eine wie immer geartete grafisch-künstlerische Anmutung. Auf der Strecke bleibt, wie er meint, das Individuelle, der persönliche Ausdruck. Die Fotografie sei aufgrund ihrer mechanischen Struktur besser geignet,"einem Gegenstand gerecht zu werden, als eine künstlerische Individualität auszudrücken." (K.H. S. 20)
- Die Gegenstände, sichtbar hier an den Wänden: z.B. die Kühltürme einer Hochofenanlage, eine Strasse mit Baum und Hof, Häuser hinter leeren Flächen im Ruhrgebiet, eine Haldenlandschaft, von Stacheldraht versperrte Vorstadtstrasse, ein Bahndamm und Bäume, Industrieprodukte sorgfältig gelegt und in die Fotofläche gestellt, Arbeiter in kundiger, handgreiflicher Harmonie mit ihrer Maschine, immer wieder anscheinend sorgsam sortierte Bäume in geordneten Waldausschnitten. Alles dies in immer gleichförmigem Licht, als gäbe es keine Tageszeiten, nicht Nacht, nicht Morgen, nicht Abend, als gäbe es weder grelles Licht noch scharfe Schatten. Dafür sieht man in möglichst genauer Zeichnung, wie sie die Grossbildplattenkamera erlaubt, die Struktur, die Oberfläche, Materialität, die Haut der Dinge in vielen Abstufungen des fotografischen Grau. Dem Gegenstand also versucht der Fotograf gerecht zu werden. Künstlerische Individualität soll, kann nicht sein? Leider? Zum Glück?
- Das O-Mensch-Pathos des Expressionismus ist längst verpöhnt. Der Historiker Klaus Honnef verweist auf eine Dialektik der Subjektiven und Objektiven, welche man zur Erklärung des Phänomens Renger-Patzsch heranziehen kann. Je genauer also dieser Fotokünstler, so muss er auch gegen seinen Willen genannt werden, seine Umgebung, seine Lebenswelt in Bildern aufzeichnet, desto einsichtsvoller wird im Laufes eines Lebens und eines umfangreichen Werkes eine persönliche Sicht und Gestaltung, das Subjekt also in einer objektivierten Bildform.
-
- Viele der Bilder, der Objekte, die Sie in dieser Ausstellungs sehen können, sind schon lange unverwechselbar als Inkunablen der Foto- und damit auch der Kunstgeschichte dem Individuum Renger-Patzsch, also dem Subjekt, unablösbar angeheftet.
- Worin liegt das Sübjektive, Individuelle, der persönliche Ausdruck?
- Klaus Honnef beschreibt diese anscheinend widersprühliche Verbindung so:"Da er (der Fotograf, J.B.) das Urteil darüber trifft, was abgelichtet wird, und zudem, aus welchem Blickwinkel, teilt er dem fotografischen Bild unweigerlich seine subjektive Anschauung der Wirklichkeit mit. Der Ausschnitt der Wirklichkeit, die Gegenstände, die ein fotorafisches Bild fixiert, werden zwar mit einer Echtheit, einer Präzision und einer Originaltreue der fertigen Aufnahme eingebrannt , die in keiner handwerklich betriebenen Bildkunst auch nur annähernd erreichbar ist. Doch es sind ebenfalls die Phänomene, die der jeweilige Fotograf ausgewählt, für abbildungswürdig befunden und durch entsprechende Mnipulationen an der Kamera in bestimmter Weise vermittelt hat. Objektivität, durch die teilnahmslose, technische Bildproduktion gewährleitet, und die Subjektivität desjehnigen, der den Auslöser des Fotoapparates betätigt, durchkreuzen einander".
- Renger-Patzsch ist kein Reisefotograf, kein die Ferne suchender Romantiker, und kein Bildjournalist, der den politischen Ereignissen und den menschlichen Dramen des Lebens und seiner Exzesse nachspührt. Krieg, Aufmärsche, Trümmer und Trauer kommen nicht vor in einem Werk, das während der schrecklichsten Zeit des 20 jahrhunderts gewachsen ist. Immer jedoch hat Albert Renger-Patzsch die Motive aus seiner unmittelbaren Lebenswelt genommen, wenn es nicht Aufträge zu Bildbänden waren, die ihm Bewegung abverlangten. Schon insofern ist sein Werk so etwas wie eine Biografie, weniger der Menschen, mit welchen er Umgang hatte, wohl aber der Dinge und Räume. Die Landschaft der Industrie um Essen ist in seiner Sicht prägend bis heute, seiner Sicht eben auschliesslich auf Räume und Dinge. Seinem bekanntesten Buch wollte er auch diesen Namen geben: Die Dinge. Es war der Verleger Kurt Wolff, der ihm den bis heute umstrittenen Titel aufredete, den Titel, und damit die Behauptung:"Die Welt ist schön". Und das im Jahr1928 ! 10 Jahre nach Kriegsende und 11 Jahre vor Kriegsbeginn. Färbt dieser Fotograf sie schön, schminkt er die Welt in seinen Fotografien?
- Man spürt auch aus die Waldbildern nicht den Hauch einer Idylle. So nüchtern hat bis heute noch kein Fotograf den Deutschen Wald porträtiert. Diese Welt ist nicht schön im bürgerlichen Selbstschutzverständnis, wohl aber in hohem Masse sehenswert. Seht genau hin, sagen diese Bilder, versucht wenigstens einen Teil von ihr zu erfassen, den Teil, der euch zur Verfügung steht und vor dem Hause liegt, ihr habt nichts anderes. Es ist dieser nüchterne Blick, der Rengers Bilder so eindringlich macht. Er schafft die Faszination des Alltäglichen, indem er es entzaubert, seine Stücke auswählt, sie und sich beschneidet und diese Fundstücke wie Objects trouvées sorgfältig und eigenwillig in die ortogonale Zwangsjacke des fotografischen Bildgevierts zwingt. Gesellschaftskritische Denker wie Walter Benjamin werfen ihm gerade dies vor:"Das Schöpferische am Fotografieren ist dessen Überantwortung an die Mode. Die Welt ist schön - genau das ist ihre Devise. In ihr entlarvt sich die Haltung einer Fotografie, die jede Konservenbüchse ins All montieren, aber nicht einen der menschlichen Zusammenhänge fassen kann, in denen sie auftritt...".
- Benjamin zitiert weiter Bertolt Brecht, den Dichter und politischen Ästhetiker, der sagt,"dass weniger denn je eine einfache Wiedergabe der Realität etwas über die Ralität aussagt. Eine Fotorafie der Kruppwerke oder der A.E.G. ergibt beinahe nichts über diese Institute. Die eigentliche Realität ist in die Funktionale gerutscht".
- Beide beziehen sich, ohne ihn mit Namen zu nennen, auf Renger-Patzsch, provoziert durch seine kühle, fast technizistische Fotografie, die ihre Stellungnahme zu den Szenen und Werten der Welt ausschliesslich aus der Stellung des Stativs bezieht und weiterreichende Aussagen und Wertungen verweigert. Sie suchten nach einer deutenden und zuletzt agitierenden Montage im aufklärerischen, auch politischen Verständnis. Auch war dies eine Forderung allgemein an die Kunst in der Zeit, die sich in einen Kampf der Systeme verstrickte. Die Arbeiterfotografie in ihrem auch visuell eindrucksvollen Klassenkampf, der Surrealismus in seinen utopischen Lebensentwürfen und der neue, gerade in Berlin sich explosionsartig entwickelnde Bildjournalismus mit seinem politischen Konfliktpotential. Ihre Künstler und Protagonisten mussten alle schon zu Beginn der Nazizeit in andere Länder flüchten, wenn sie nicht eingeserrt und umgebracht wurden. Tatsächlich hat sich die neusachliche Fotografie von Renger-Patzsch und anderen in den bösartigen Entwicklungen des Dritten Reiches, des Krieges und nicht zuletzt in der Konsumphase der 50er Jahre zwischen Industrie- Werbe und Dokumentarfotografie jenseits von politischem Engagement und weithin jenseits auch von ideologischer Serviität behaupten können. Man darf sie nicht fragen ach dem, was sie nicht gesehen hat, man muss, um ihr gerecht zu werden, betrachten, was sie uns zeigt, und das auch aus der Sicht des Betrachters, der ja nachträglich die Position des Fotografen einnimmt, wie dieser so nüchtern und so genau wie möglich. Diese Fotografie steht der Werbung nur als klare Sachfotografie, der Selbstdarstelung der Industrie als Dokument von Archtektur, Raum, Mensch und Maschine zur Verfügung und sogar dem Heimatgefühl und dem Tourismus als kühle, aufzeichnende Abbildung von historischen Bauten und Landschaften.
- Noch die Autorenfotografie der Schürmann, Mantz, Riebesehl der 70er Jahre, welche den Begriff Dokumentafotografie durch die Kunstbezeichnung Dokumentarismus zuspitzten, der Sachfotografie und Industriefotografie der Windstösser, Moegle, Hallensleben bis hin in die serielle Industriearbeit des Paares Bernd und Hilla Becher ist mehr oder weniger erfasst von der Vorstellung und Verwendung einer nüchternen, genau abbildenden Kamera, wie sie sehr früh und sein ganzes Arbeitsleben hindurch Albert Renger-Patzsch vorgeführt hat. Seine Thematik und seine Bildform weisen eine eigentümliche Konstanz, um nicht zu sagen, Starre auf. Man muss schon die Bildtitel lesen, um anhand der Daten eine zeitliche Einordnung zu finden, eine stilistische Fortentwicklung oder Variation wird es nicht geben. Ob man sich die Bilderder 2oer oder der 60er Jahre vornimmt, Unterschiede gibt es anhand der Wandstrukturen oder der Inschriften, nicht aber im Stil, und diese eigentümlche Zeitlosigkeit gerade in einem so zeitbezogenen und zeitabhängigen Medium wie der Fotografie. Bis zuletzt zieht sich zeitlos durch Regers Werk der Wald in seinem zeit- und menschenunabhängigen Auftritt. In immer neuen und ewig alten Ansichten und Kompositionen breiten Stammgruppen und einzelne Baumgiganten sich vor uns aus inmerkwürdig sortirter und aufgeräumter, fast gesäuberter Anordnung. Auch dahinter verbirgt und zeigt sich der Fotograf in seiner Existenz. Im Werk des über sechzigjährigen, also im Jahrzehnt bis zu seinem Tode, und auch in dieser Ausstellung, im einem fotografischen Werk, das fast menschenleer ist, überwiegen die Bäume als Zeichen des Lebens und der Dauer.
-
- Herford, 5.2. 2000
- Jörg Boström
- Lit. Albert Renger-Patzsch, Fotografien 1925-1969 Bonn 1977, Klaus Honnef, Der Zeitgenosse, Bemerkungen zum fotografischen Werk von Allbert.Renger-Patzsch
| |